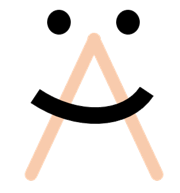
AndräsCoaching
BLOG
Wir sind natürlich unperfekt-perfekt
In letzter Zeit taucht der Begriff der „Resilienz“ wieder verstärkt auf. Vor dem Hintergrund der Krisen unserer Zeit scheint Widerstandskraft besonders von Nöten. Es gibt viel Forschung und Modelle zu diesem Thema (#antonovsky #salutogenese #7säulenderresilienz #andmanymore). Ich möchte damit verknüpft eigene Resilienz-Erfahrungen – als Betroffene und auch als Begleitung von Betroffenen- teilen, Impulse geben und zum Austausch anregen.
Für mich als chronisch erkrankte Person ist Resilienz eng verknüpft mit Coping, also der Entwicklung von Bewältigungsstrategien; aber auch mit Versatilität, einer besonderen Art Anpassungsfähigkeit und natürlich mit Glück&Wohlbefinden (Link). Resilienz hat für mich besonders mit der Bereitschaft zu tun, das eigene „Normal“ immer wieder in Frage zu stellen und der Fähigkeit, einerseits sicher den eigenen Kompass zu nutzen und andererseits innere Muster zu brechen. Identität als veränderbar zu verstehen und im Kern dennoch konstant. Sich im Loslassen und gleichzeitig im Halten zu üben.
Im Zusammenhang mit ihrer Erkrankung stellt sich immer wieder die Frage: wie definieren wir überhaupt Gesundheit? Ist es das „Normale“, das „Vollständige“ oder gar das „Vollkommene“ und „Perfekte“ und Krankheit ist dann entsprechend „unnormal“, eine Situation des „Mangels“, „unvollkommen“ und „unperfekt“?
Ich will nicht sagen, dass ich froh bin, eine chronische Erkrankung zu haben, die den Umgang mit spontanen, durchaus bedrohlichen Ereignissen erfordert. Natürlich wäre ich lieber vollständig gesund – Aber wer ist das schon? Und gleichzeitig sind wir, die wir mit unseren täglichen gesundheitlichen Herausforderungen zu arbeiten haben, in stetigem Training einiger skills, die mit Blick auf Krisen in Zukunft mehr denn je erforderlich sind. Dazu gehört auch der achtsame Umgang mit den eigenen Ressourcen ohne auf den Mangel daran zu fokussieren. Aus meiner Erfahrung als Betroffene und Coach kann ich sagen, dass es vielen chronisch Erkrankten so geht. Dass sie den Veränderungsprozess gut gehen können und sich am Ende vielleicht sogar eher als chronisch gesund empfinden: als ganz natürlich „unperfekt-perfekt“.
Zwangsläufig gechanged worden vs. selbstbewirkte Verwandlung
Wenn mich Neu-Diagnostizierte kontaktieren, fragen sie mich jedoch meistens zunächst nach diesem „Normal“, an dem sie nachvollziehbarerweise so hängen: „Und? Wie lebst du so? Ist es sehr anders für dich oder ganz normal?“ Sie wollen wissen, ob sich nun alles verändert. Alte Vorstellungen lösen sich auf, Muster, Glaubenssätze, alte „Säulen“ werden brüchig. Sie sind plötzlich in diesen ungewollten „Change-Prozess“ hineingeworfen. Insbesondere Menschen mit Erkrankungen, die mit plötzlichen, lebensbedrohlichen Symptomen einhergehen, haben mit massiven Anpassungsherausforderungen zu kämpfen. Letztlich ist es der Verlust der Vorstellung von einem „normalen“, „gesunden“ Leben und die Angst vor Verlust des Bisherigen und der Veränderung, die damit zwangsläufig einhergeht. Zwangsläufigkeit beinhaltet gleich zweimal Aspekte des Ausgeliefertseins: einmal als Gegenteil von Freiwilligkeit und zweitens als etwas, das seinen Lauf nimmt und uns mitreißt, ohne, dass es etwas dagegen zu tun gäbe. Sowohl Freiwilligkeit als auch Handlungsfähigkeit und ein gewisses Maß an Selbstwirksamkeitserfahrungen sind jedoch grundlegende Voraussetzung für echte innere Arbeit (und nicht nur Ziel).
Daher kann es im Coaching mit chronisch Erkrankten auch wichtig sein, zunächst dieses Gefühl des Ausgeliefertseins zu identifizieren, um dann damit – und zunächst nicht dagegen – zu arbeiten. Es anzunehmen, dass wir uns ins kalte Wasser geschmissen vorfinden, ohne gut genug schwimmen zu können, um wieder an das bekannte Ufer zu kommen. Ressourcensparend sanft zu steuern, zu regulieren und wieder in das Vertrauen zu finden, dass wir uns orientieren und neu ausrichten können, auch in neuen Lebenslandschaften.
Resilienz als future skill und Lifehack chronisch Erkrankter
Manchmal liegt in diesen Veränderungsprozessen eine solch große Kraft, dass es zur wahren Neukonstruktion dieser (inneren) Landschaften kommt. Daher haben chronisch erkrankte Personen zuweilen echte Transformationserfahrungen gemacht bzw. sind im ständigen Übergang. Und ich frage mich, ob darin nicht auch eine Weisheit liegt, die wir nutzen können: warum werden Menschen mit Erkrankungen bzw. Behinderung immer noch häufiger ausgeschlossen als inkludiert? Warum schauen wir uns im Gegenteil nicht diese Erfahrungen verstärkt an, sprechen noch mehr mit den Menschen, die diese zukunftsrelevante „Veränderungskompetenz“ täglich unter Beweis stellen? Personen, die durch „Verwandlungsprozesse“ gegangen sind oder für die alltägliche Anpassung an das „neue Normal“ wiederum ganz „normal“ ist, immer wieder. Die den Mut haben, loszulassen und gleichzeitig enorme Stamina zeigen. Für die Herausforderungen und damit einhergehende Selbstregulation zur täglichen Routine gehört. Die Akzeptanz des bisher „Fremden“ gelernt haben, den Umgang mit dem Unbekannten, der eigenen Unzulänglichkeit und Unvollkommenheit? Die es verstehen, realistischen Zielsetzung optimistisch nachzugehen und die Verantwortungsbereitschaft zeigen, das Leben (wieder) dankbar in die Hand zu nehmen – trotzdem und weil die Teilhabe daran keine Selbstverständlichkeit für sie ist.
8 Millionen Menschen in Deutschland leben mit einer schweren Behinderung. Das sind immerhin 10% unserer Bevölkerung. Hier könnte ein großer Erfahrungsschatz liegen. Ein Schatz, der noch heller glänzt, wenn wir diese Menschen empowern.
Wandertricks



Wandern hat ja so etwas Entschleunigendes und Sinnliches. Auch etwas Sinnbildliches: es geht auf und ab, es gibt einen Weg, Kreuzungen, an denen man sich entscheiden darf, man muss sich den Gegebenheiten anpassen, bei schlechtem Wetter Schutz suchen oder einfach genüsslich durch den Regen laufen, es gibt Begegnungen und Mitwanderer. Alles wunderbare Metaphern, mit denen wir im Coaching – auch im Selbstcoaching – super arbeiten können. Wenn ich mit meinen Klienten in der Natur unterwegs bin, kommen die Bilder ganz von alleine. Man benötigt kein Material, keine Karten, keine Figuren, nichts. Es ist alles vor Ort. Das liebe ich so an diesen Walk&Talk Formaten.
In diesem Sommer bin ich viel gewandert und mir ist diese Kraft des Wanderns noch einmal sehr bewusst geworden und ich habe mir ein paar Strategien erarbeitet. Mit meiner Lungenerkrankung ist das Wandern in den Bergen, insbesondere ab knapp 2000m Höhe eine große Herausforderung.
Bergauf bin ich langsam. Das sieht auf dem Video fast schneller aus, als es ist. Glaubt mir, ich bin seehr langsam. Der Austausch von CO2 und Sauerstoff dauert einfach etwa doppelt so lange als bei Personen, deren Lungen im Normalbereich arbeiten.
Zu Beginn ist es im Urlaub in den Bergen immer so: ich bin frustriert. Ich denke „Oje, schlimmer als letztes Jahr!“. Wenn mir Leute entgegenkommen denke ich „Was die jetzt über diese rotgesichtige, laut schnaufende, sich im Schneckentempo hochkämpfende, doch eigentlich recht fit-aussehende Frau denken!!?“
Ich schäme mich dann tatsächlich. Werde wütend. Hasse es. Ich könnte sogar heulen.
Ich glaube, ich brauche diesen Moment. Gut ist, dass er immer kürzer wird und weniger intensiv. Mittlerweile wandele ich diese Gefühle schneller um. Am Ende schleiche ich lächelnd auf die Alm. Was mir hilft?
- Wutenergizer: Ich bin dankbar für den Frust, die Wut, denn ich kann sie in positive Energie umwandeln und nutzen!
- Inneres Bild: Ich bin also eine „Energieschnecke“ (kennt ihr noch die Rennschnecke aus der Unendlichen Geschichte?), die langsam aber stetig, in ihrem Tempo, den Berg erklimmt.
- Lyrics für „meinen song“/Affirmationen: Ich denk mir rhythmische Sätze aus. Weil ich auch Musik mache, kann das sogar ein kleiner Ohrwurm werden, der mich begleitet.
- Wahrnehmung schärfen: besonders wenn’s schwierig wird, immer bei einer Pause, aber auch während des ganzen Weges, nutze ich alle Sinne, um meine Langsamkeit zu genießen…wie die Schnecke mit ihren achtsamen Fühlern.
- Kurven gehen: Wenn es steil ist, gehe ich im Zick-Zack nach oben, um die Steigung zu verringern. Dann gehe ich zwar doppelt so weit, dafür ist der einzelne Schritt nicht so anstrengend. Ich dosiere das, wie es passt.
- Dankbarkeit: oh ja. Für das, was noch geht, für diese herrliche Natur, für meine Lieben, die mich begleiten.
- Verbundenheit: ich geh ja nicht alleine. Ich bin in bester Begleitung. Ob ich nun mit mir selbst unterwegs bin (auch völlig ok) oder wie jetzt mit meinem lieben Mann und meinem tollen Sohn. Die beiden unterstützen mich so sehr. Ich bin so dankbar, dass sie da sind!
- Feiern: Nicht nur oben (da sowieso, und da belohne ich mich auch mit Kaiserschmarrn!), sondern auch zwischendurch immer mal, feiere ich mich, meine Lungen, die Natur, meine Familie,…Ich bin stolz auf mich
All diese Punkte sind nachweislich Faktoren, die zu Glück (im Sinne von Wohlbefinden) und damit zu Resilienz beitragen:
- Der bewusste Umgang mit Emotionen (gehört zur emotionalen Intelligenz)
- Affirmationen und starke, positive innere Bilder (zur Stärkung der Herzintelligenz)
- das sogenannte Savoring (bewusster Genuss sinnlicher Wahrnehmungen)
- Anpassungsfähigkeit im Sinne einer „inneren“ Beweglichkeit (Versatilität)
- Dankbarkeit und Konservierung guter Momente (tiefe innere Verankerung)
Glücksfaktor Nummer 1: gute Beziehungen, tiefe Verbundenheit – zu sich, zu Anderen, zur Natur.
Es ist immer wieder erstaunlich, wie eigentlich alles in uns bereits selbst liegt. Es geht meist „nur“ um Klärung, Bewusstmachung und letztlich um Training: je häufiger wir diese Dinge in unserem Alltag üben, in kleinen, einfachen Situationen, desto mehr können wir hier neue neuronale „Glücksspuren“ legen und verbreitern.
Langohr-Learnings



Dann habe ich in Sachen Langsamkeit noch etwas gelernt, und zwar auf meiner Eselswanderung.
Mit einer Freundin bin ich in Südfrankreich eine Woche mit einem Esel namens Wakane mitten durch die Natur gewandert. Ich durfte noch nie eine so wunderschöne Landschaft so „mittendrin“ erleben. Wir haben in türkisfarben-klarem Bergflüssen gebadet, sind durch die schönsten Kräutergärten, die Mutter Natur einfach so unperfekt-perfekt angelegt hatte, wie man es selbst nie könnte, haben die Aussicht genossen, auf dem Waldboden Nickerchen gemacht und mit unserem Esel eine Beziehung aufgebaut. Der Esel. Unser Esel tat vor allem eines: er fraß. Der reich gedeckte Tisch seitlich des Weges bot ihm allerlei Wildkräuter, was das Eselherz stets auf Neue erfreute. Es wuchs zu Hauf, in Vielfalt und Abwechslung. Welcher Esel kann sich da beherrschen?
Meine Langohr-Learnings:
Wir kommen sowieso an:
Der Esel frisst. Und deshalb geht es langsam. Wirklich langsam. Und dann braucht es eines: Geduld. Und Zuversicht, dass wir dennoch irgendwann ankommen. Sowieso. Denn…
Der Weg ist das Ziel:
Der Esel frisst. Wir bleiben stehen. Wir schauen uns um. Wir reden. Wir sind stumm. Wir betrachten die Blumen. Die Aussicht. Die Ameisen. Diese schwarzen Hummeln (die sind ganz anders hier). Spüren den Wind. Es geht wieder weiter, wenn es eben weitergeht.
Pausen sind Teil des Weges:
Der Esel frisst. Wir auch. Das Essen ist herrlich. Wir machen ein Nickerchen im Moos. Der Esel braucht seine lange Mittagspause. Und seine vielen kleinen Pausen. Was gibt es schon zu tun außer gehen und pausieren und essen und reden und schauen?
Widerstand entsteht durch Druck:
Der Esel bockt. Dann geht nichts mehr. Nichts. Der Esel ist sehr stark, er zieht locker 300kg, wenn er will. Oder steht dort mit 300kg. Und steht dort und steht. Wer hier jetzt zieht oder drückt hat verloren. Es geht nur so: Impuls durch einen Ruck. Die Richtung anzeigen durch Ausrichtung des Körpers nach vorne. Jetzt noch der absolute Glaube, die Gewissheit: wir gehen jetzt weiter. Impuls von hinten: wir gehen weiter. Der Esel geht nicht schneller, wenn man schiebt oder reißt – so, wie das Gras nicht schneller wächst, wenn man daran zieht.
Einfachheit und Schönheit sind best buddys:
Der Esel geht. Wir gehen mit. Um uns herum die Schönheit der Natur. Mittendrin wir. Morgens geht es los, dann gehen wir, dann kommen wir an. Mehr gibt es nicht zu planen oder zu tun. Wunderbar.
Klarheit und Fokus sind manchmal ungemein wichtige Grundvoraussetzungen:
Der Esel steht. Wir wollen gehen. Oder wollen wir doch nicht? Quatschen wir lieber? Oder will die Eine das, die Andere das? Haben wir unterschiedliche Vorstellungen vom nächsten Schritt? Dann klappt es nicht. Wir müssen das Gleiche wollen und signalisieren, sonst ist der Esel verwirrt – und bei Verwirrung frisst er lieber, das ist klar. Und dann geht es nicht weiter. Ist das denn ok? Oder fühlt sich jemand nicht gesehen und gehört?
Rücksichtnahme und Toleranz sind nämlich auch Grundvoraussetzung:
Der Esel will fressen, Eine will gehen, die Andere Fotos machen. Jeder Jeck ist anders, wie der Kölner sagt. Unterschiedliche Bedürfnisse – und jetzt? Was kann ich tolerieren, wo ist meine Grenze? Das gilt es immer wieder auszuhandeln – vor allem mit mir selbst.
Geschenke sehen wir manchmal erst hinterher:
Der Esel hat auf jeden Fall auf mich Rücksicht genommen, denn er ist extra langsam gelaufen, so dass ich am Ende sagen konnte, „Die Höhenmeter haben mir überhaupt nichts ausgemacht. Ich hätte statt 400hm auch 1000hm am Tag laufen können“, anstatt meine Befürchtung zu bedienen, dass ich es vielleicht nicht schaffe, dass es zuviel sein könnte. Der Esel hat mir gezeigt, dass es völlig ok ist, langsam zu sein. Geduld ist nicht meine Stärke, danke für das Training, mein lieber Wakane!

#chronischkrank #copingskills #achtsamkeit #resilienz #schneckentempo #meintempo #growthmindset #bergauf #langsamkeit
Phasen der Erkrankung - oder: die große Überfahrt
Charakteristisch für chronische Erkrankungen ist die Unvorhersehbarkeit ihres Verlaufs. Dies kann zu einer dauerhaften Unsicherheit führen, da es immer wieder neue Herausforderungen gibt, denen man sich stellen muss. Das Ganze ist ein sehr dynamischer Prozess, mal mehr, mal weniger spürbar.

Beim Trajekt-Modell (Korber/Strauss 2010, wurde aber durch Strauss auch schon in den 60er Jahren untersucht, Buch „awareness of dying“) handelt es sich um ein theoretisches Konzept, das die verschiedenen Phasen einer chronischen Erkrankung würdigt. Es hat zum Ziel, die zur jeweiligen Krankheitsphase passende Betreuungssituation zu schaffen. Trajekt kommt von lat. trajectum und bedeutet Überfahrt oder auch Fähre/Fährschiff. Chronisch Erkrankte befinden sich in einem ständigen Übergang. Das tun wir natürlich alle irgendwie. Dem Konzept der Salutogenese nach (Antonovsky und andere) bewegen wir uns schließlich ständig mal mehr oder weniger dynamisch zwischen den beiden Polen zwischen Gesundheit und Krankheit. Was heißt das eigentlich – gesund sein?
Die WHO sagt definiert den Begriff „Gesundheit“ als “Zustand völligen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens und nicht nur das Freisein von Krankheit und Gebrechen”. Es wird deutlich, dass Gesundheit:
- ein eigenständiger, positiver Zustand ist
- von unserem subjektiven Wohlbefinden abhängt
- mehrere Dimensionen beinhaltet, nämlich:
– die physische – die psychische – die soziale
Kritisieren kann man hier in jedem Fall die deterministische, utopische, unrealistische Ausrichtung der Definition. Es wird von einem Zustand gesprochen, den man irgendwie erreichen kann. Und wann hat man eigentlich diesen Zustand des „völligen“ Wohlbefindens jemals?
Und wie sieht es mit dem Begriff der „Krankheit“ aus? Erstaunlicherweise findet man hier so leicht keine allgemeingültige Definition, außer vielleicht die Umkehrung des Begriffs der Gesundheit. Wenn es innerhalb der genannten Dimensionen, ob nun in der des Körpers, der Seele oder auch der gesellschaftlichen Teilhabe in gewisser Weise Störungen gibt. Klar wird jedoch, wenn man hier weiterliest, dass diese Störungen alltäglicher Bestandteil des Lebens sind. Oft fällt uns Erkrankung gar nicht auf, gerade wenn wir aus der „Welt der Gesunden“ kommen – dann aber, wenn wir krank sind, nehmen wir plötzlich viele Menschen wahr, die auch krank sind. Wahrscheinlich ein Effekt selektiver Aufmerksamkeit? Um es zu objektivieren: 40% der Menschen in Deutschland haben eine chronische Erkrankung. Das sind schon eher Viele. Vielleicht haben wir also eher vorher, wenn wir gesund sind, einen verengten Blick auf die Wirklichkeit?
Wie dem auch sei – zurück zu den Phasen. Die Untersuchungen zu den Krankheitsverläufen vieler Patient:innen führten zu einer Einteilung, die sicherlich auch nicht ganz linear und natürlich immer sehr individuell verlaufen kann. Es ist eben ein Modell und Modelle vereinfachen immer. Wir folgen diesem Modell nun mal und beginnen mit der Phase des sogenannten Vortrajekts: anfangs merkt man, es stimmt irgendwas nicht mit dieser „Fähre“ auf der man fährt, oft rennt man von Arzt zu Arzt und je nach Häufigkeit des Vorkommens der Erkrankung und je nachdem wie typisch oder atypisch die Symptomatik, desto schneller wird oft diagnostiziert. Ok, es kommt natürlich noch der Faktor Versicherungsstatus hinzu… Und der Faktor Glück. Und sicher ein paar andere Faktoren. Jedenfalls fährt man dann recht zwangsläufig erstmal aus dem Nebelgebiet der Vortrajektphase heraus in die stockfinstere Dunkelheit der Diagnose. Mit dem U-Boot in die Tiefen der Abyss. Schock. Verzweiflung. Unglaube. Nicht-Akzeptieren-Wollen. Warum ich. Das ganze Spektrum. Vorallem: Angst.
Nach einiger Zeit dann, zeigt sich an der Oberfläche ein kleines Licht. Die Szenerie hellt auf, die Gedanken erhalten wieder so etwas wie Logik, die Amygdala beruhigt sich. Im besten Fall lernt man, die eigene sich auf natürliche Weise einstellende Resilienzreaktion bewusst zu fördern und gewinnt somit schneller und nachhaltiger ein wenig zurück an Optimismus, beginnt Unvermeidliches mehr zu akzeptieren, Verantwortung zu übernehmen, Beziehungen anzupassen und sich neu im Leben auszurichten. Im Optimalfall gewinnt man sogar in all diesen Bereichen hinzu. Die Phase der Normalisierung hat begonnen. Schließlich: Oberfläche. Atmen. Innehalten. Die Phase der Stabilisierung. Wir hoffen auf lange Zeit in ruhigen Fahrwassern.
Typischerweise jedoch folgt auf diese Phase im Verlauf der Erkrankung früher oder später eine neue Herausforderung: die Akutphase. Die Aktutphase ist durch ähnliche Schockzustände wie die der Diagnose gekennzeichnet, meist abgemildert, da man ja nun bereits eine Weile mit der Erkrankung zusammen durch´s Leben fährt. Es kann aber auch wieder zu einem ähnlich starkten Einbruch des Wohlbefindens kommen, Strudelgefahren, da im typischen Fall ja von einem bereits niedrigeren Plateau nun wieder ein Schritt nach unten gezogen wird. Und damit ein Level erreicht wird, das – von der rein körperlich-daten-fakten-zahlen-Seite aus… – richtig mies sein kann. Ich empfinde Akutphasen als besonders herausfordernd. Es kostet ein Höchstmaß an Resilienz, an richtig-richtig-harter Arbeit, um hier wieder zurück auf eine kleine Insel oder zumindest zurück in ruhigere Gewässer der Erkrankung zu finden.
Recht wahnsinnig ist dann, wie sich die subjektive Wirklichkeit hier teils so rasant verändert. Alles schrumpft zunächst wieder auf die Krankheit zusammen, die Welt besteht aus Krankenhausfluren, OP-Hemdchen und Visiten. Aus morgendlichen oder auch gerne mal nächtlichen Weckmanövern durch überarbeitete und häufig dennoch nette Krankenpfleger:innen und Statements von Ärzten, die so niederschmetternd sein können, dass man dieses Fiepen im Ohr bekommt und diesen Tunnelblick, kurz vor dem Ohnmächtigwerden. Dabei hatte man sich doch gerade so eingegroovt mit der Erkrankung. Und nun: wieder alles auf Anfang. Oder eben doch nicht. So eine Akutphase hat immer etwas ganz Eigenes und Neues. Und dennoch hat man ja schon Routine und die Widerstandskraft ist im günstigen Fall deutlich gewachsen.
Ich hatte jetzt so eine Akutphase. Diesmal war es besonders heftig und ich bin extrem froh, dass ich meine Strategien zur Bewältigung der Erkrankung offensichtlich recht nachhaltig verinnerlicht hatte. Ich wäre ansonsten nicht hier wo ich jetzt bin, ganz sicher nicht. Nach 6 Monaten geprägt von Luftnot, Krankenhaus, alleine 2,5 Monaten Schlauch im Thorax und schließlich einer ausgedehnten OP mit Wochen der Rehabilitation, beruflichem Wiedereinstieg in baby steps.
Und jetzt? Genese ich.Und mache – ganz wie es eben einer „Genese“ zu eigen ist – eine Entwicklung durch, entstehe neu. Bin wieder auf meiner Fähre, auf der Überfahrt und schaue auf das, was war und das, was ist. Und mache etwas, das nachweislich zur Genesung beiträgt: ich bin sehr, sehr dankbar.
Was war, was ist – immer im Wechsel, Bild für Bild. Es liegen keine 5 Monate dazwischen. Es könnte auch anders beginnen, mit dem guten Zustand, der durch den schwierigen abgelöst wird. Wie man es nimmt. Diese Phase nennt sich dann „Im Auf- und Ab der Erkrankung„.
Letztlich sind es Wellen, in denen wir uns bewegen auf unserer Überfahrt.
Keine Ergebnisse gefunden
Die angefragte Seite konnte nicht gefunden werden. Verfeinern Sie Ihre Suche oder verwenden Sie die Navigation oben, um den Beitrag zu finden.